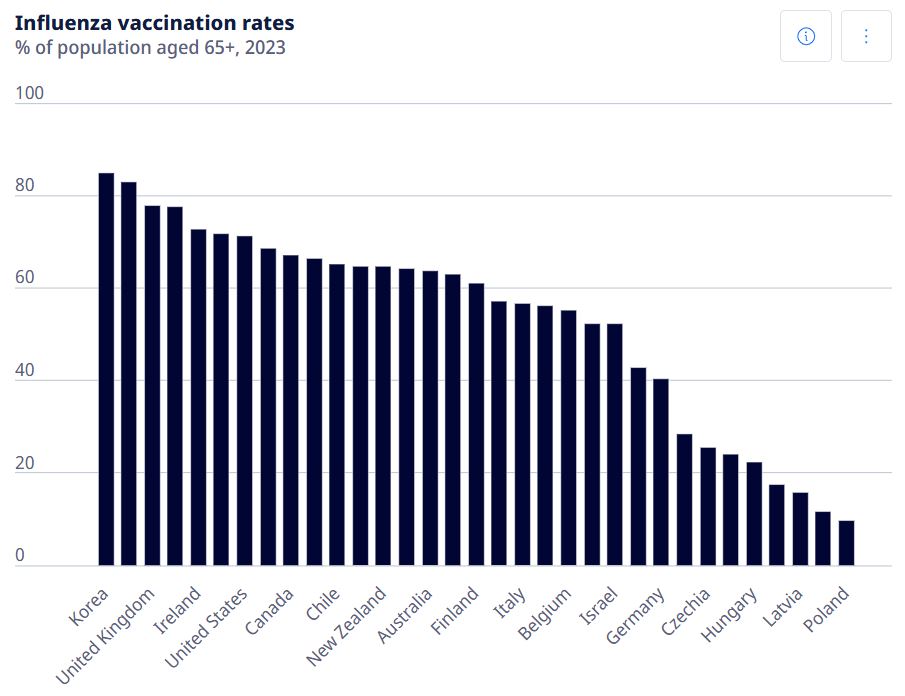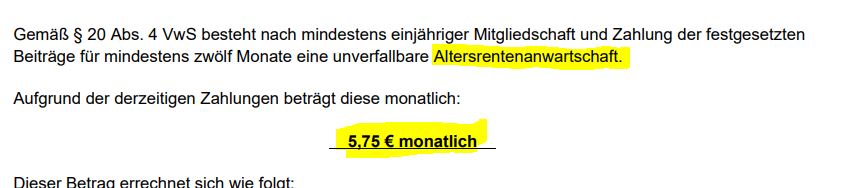In vielen Ländern und Familien tobt ein Kampf darum, ob der 24. oder der 25. Dezember das eigentliche Weihnachten ist. Die orthodoxen Kirchen in Osteuropa lassen sich bekanntlich Zeit und feiern erst am 7. Januar, so dass mehr Zeit zum Tannenbaumabsägen und zum Plätzchenbacken bleibt.
Ein Land jedoch tanzt vollkommen aus der Reihe: Das vorgeblich katholische Spanien feiert sein Weihnachten jedes Jahr bereits am 22. Dezember.
Wer jetzt fragt „Warum die Eile? Was soll der Stress?“, dem sei gesagt: Der Weihnachtsstress fängt schon im Juli an. Ab da werden nämlich die Tickets zum großen Fest verkauft.
In jeder Kirche, die ich in Andalusien besichtigte, wollte mir jemand Tickets andrehen. Zuerst am Eingang, dann kam der Mesner, schließlich der Pfarrer. Alle: „Haben Sie schon ein Ticket für Weihnachten?“
Zuerst antwortete ich wahrheitsgemäß, dass ich an Weihnachten gar nicht mehr in Spanien sein würde. Das führte zu keinem Nachlassen der Verkaufsbemühungen: „Das macht nichts, es wird live im Fernsehen übertragen.“
Ich verstand nicht, wieso ich Eintrittskarten für etwas erwerben sollte, das ich gratis im Fernsehen sehen könnte. Irgendwann wurde es mir zu aufdringlich, und ich änderte meine Ausrede: „Oh, vielen Dank, aber ich habe schon ein Ticket.“
Damit sollte ich aus dem Schneider sein, dachte ich.
Weit gefehlt: „Kaufen Sie doch noch eins!“ wurde ich ermutigt.
Eine Aufforderung, der anscheinend das ganze Land folgt, wie die langen Schlangen vor den Verkaufsstellen zeigen.

Irgendwann fand ich heraus, dass Weihnachten in Spanien nicht mit Bäumen, Geschenken und Essen gefeiert wird, sondern mit Glücksspiel. In Spanien ist Weihnachten ein Synonym für die Lotterie.
Und jeder muss mitmachen! „Hast du schon Lose gekauft?“ wurde ich immer wieder gefragt, auch von Freunden, die mir nichts verkaufen wollten.
Um mich nicht auf Diskussionen einzulassen, sagte ich einfach: „Ja.“
Aber da fing die Fragerei erst an: „Welche Nummer hast du?“
„Wieso ist das wichtig?“ wunderte ich mich.
Ich meine, ich verstehe schon das Prinzip einer Lotterie und dass die Nummer wichtig ist für den Gewinn. Aber ich verstehe nicht, wieso meine Losziffer für andere von Interesse sein könnte.
„Na, vielleicht haben wir die gleiche Nummer!“ riefen die Freunde begeistert, wie wenn das eine Art Blutsbrüderschaft bedeutet.
Eine Lotterie, die Lose mit den gleichen Nummern mehrfach verkauft, erschien mir eher wie eine Betrugsmasche. Mir begann zu dämmern, wie der Spanische Bürgerkrieg ausgelöst worden war, als eines Tages zwei Leute mit der gleichen Ziffer den Hauptgewinn abholen wollten.
Aber dann wurde ich aufgeklärt:
Die Spanische Weihnachtslotterie, stolz bestehend seit 1812 und weder durch Welt- oder Bürgerkriege, noch durch unfairerweise nach dem Land benannte Grippewellen unterbrochen, ist die größte, wichtigste, wertvollste und superlativste Lotterie der Welt. Jedes Weihnachten werden mehrere Milliarden (!) Euro ausgespielt.
Aber, Tradition ist Tradition, die Lose dürfen nur fünf Ziffern haben. Somit gibt es nur 100.000 mögliche Losnummern (von 00000 bis 99999). Etwas wenig für ein Land mit 47 Millionen Einwohnern, denn schließlich will jeder Bürger mindestens ein Los.

Andere Länder würden auf sechs- oder siebenstellige Losnummern umsteigen, aber Spanien ist kreativer: Man druckt die gleichen Losnummern mehrfach. Und wenn das Los gewinnt, dann teilt man den Gewinn. So einfach geht das. Teilen macht Freude!
Halt! So läuft es beim knausrigen deutschen Lotto. In Spanien hingegen, wo soziale Gerechtigkeit Verfassungsrang hat, führen mehrere Gewinnerlose dazu, dass jeder Losinhaber den vollen Gewinn erhält. Hier wird nicht geteilt, hier wird multipliziert!
Und da die Lotteriegesellschaft dem Staat gehört, schießt der Staat im Notfall einfach das Geld zu. Jetzt wisst Ihr, warum sich Spanien gerade 140 Milliarden Euro aus dem EU-Corona-Aufbaufonds gesichert hat.
Aber ich glaube, es werden immer genug Lose verkauft, um den Topf ausreichend zu füllen. Letztes Jahr wurde jede Nummer 170 Mal ausgegeben, also insgesamt 17 Millionen Lose.
Theoretisch.
Denn jetzt wird es wirklich kompliziert. Ich habe mir das dreimal erklären lassen müssen, um es Euch einigermaßen darlegen zu können. Aber alle Angaben sind, wie immer beim Lotto, ohne Gewähr!
Weil 17 Millionen Lose noch immer nicht für 47 Millionen Einwohner ausreichen, werden die Lose geteilt. Und zwar nicht ideell oder durch Geheimabsprachen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes zerschnippelt. Die Lotteriegesellschaft hat dagegen keine Einwände, sondern bietet jede Losnummer in jeder Serie als Bogen mit zehn Kupons an, die man abtrennen und einzeln kaufen und verkaufen kann.

Die auf diese Kupons entfallenden Gewinne werden jedoch, anders als die auf die gleichen Nummern in verschiedenen Serien entfallenden Gewinne, durchaus geteilt, und zwar nach dieser Formel:

In Spanien werden vor Weihnachten viele Taschenrechner verkauft.
Dafür kostet jeder Kupon nur ein Zehntel des Preises eines ganzen Loses. Das ist wiederum sehr sozial, denn ein gesamtes Los kostet happige 200 Euro, was sich niemand leisten kann. Also kauft irgendjemand den ganzen Bogen und verkauft neun Zehntellose weiter. Deshalb wird man auch im Bahnhof, im Park, beim Händewaschen, auf dem Flughafen, bei der Verkehrskontrolle und vor allem in jeder Bar angesprochen, ob man nicht einen Kupon erwerben möchte.
So sieht ein Los aus: In der Mitte die fünfstellige Losnummer (88485), rechts oben die Serie (168), darunter die Nummer des Kupons (1 von 10). Und der Preis von 20 Euro, weswegen ich mir den Spaß nie gegönnt habe.

Weil, wie ich schon gejammert habe, 20 Euro noch immer viel Geld sind, werden die Kupons noch einmal geteilt. Da gleiten wir aber vom offiziellen ins inoffizielle Wettgeschäft ab, denn die Kupons darf man nicht noch einmal zerschneiden. Stattdessen trifft man im Park auf Leute, die Fotokopien von ihren Kupons verkaufen und dafür versprechen, einen am Gewinn zu beteiligen. Man kauft also eine Kopie, wobei der Verkäufer natürlich den Beteiligungsquotienten mitteilt, und hinterlässt bei dem fliegenden Händler seine Telefonnummer zur Gewinnbenachrichtigung an Weihnachten.
Die Menschen in Spanien sind sehr ehrlich.
Besonders verbreitet sind diese Partizipationsgeschäfte (die der Idee von Aktienfonds nicht unähnlich sind) unter Gruppen, die am Weihnachtsabend zusammen feiern und fiebern wollen: Familien, Arbeitskollegen, die Stammkundschaft in einer Kneipe, Sportmannschaften, die Besatzung der Internationalen Raumstation, Gefängnis- oder Altenheiminsassen.
Bekanntlich gibt es nichts Kompliziertes, was nicht noch komplizierter gemacht werden kann:
Um Fälschungen zu unterbinden, muss die Lotteriegesellschaft einen Überblick behalten, welche Lose mit welchen Nummern von welcher Serie sie an welche der 3.420.591 Verkaufsstellen ausgeliefert hat.
Nun gibt es Leute, die eine bestimmte Losnummer wollen. Vielleicht das Geburtstdatum. Oder die Ziffer, die letztes Jahr gewonnen hat. Oder eine Ziffer, die noch nie gewonnen hat. Oder die Zahlen, die die Wahrsagerin in der Straße hinter der Stierkampfarena weisgesagt hat – natürlich gegen Gewinnbeteiligung.
Weil die Lotteriegesellschaft eine staatliche ist und weil die Verwaltung in Spanien sehr bürgerfreundlich ist, kann man dort anrufen und fragen, an welches Kiosk im großen, weiten Land (zu dem bekanntlich auch Landstriche in Afrika und im Atlantik gehören) die gewünschten Nummern ausgeliefert wurden. Viele Spanier nutzen dann die Sommerferien, die Herbstferien, Streiktage oder die Frühverrentung, um durchs Land zu fahren und die Wunschlose zusammenzukaufen.
Eine weitere Form des Lotterietourismus ergibt sich, wenn eine Verkaufsstelle im letzten Jahr das große, fette Gewinnerlos („El Gordo“) verkauft hat. Ich weiß nicht, warum, aber Hunderttausende von Menschen fahren dann im aktuellen Jahr zu eben jener Verkaufsstelle, um mindestens 20 Euro zu hinterlassen.
Und wenn das Gewinnerlos an einer Tankstelle verkauft wurde, dann verkauft diese Tankstelle im folgenden Jahr kein Benzin mehr, weil niemand 3 Stunden zwischen lauter Glücksrittern anstehen will, um die Tankfüllung zu bezahlen.

In diesem Fall war es besonders krass, weil die Tankstelle auf Teneriffa liegt. Viele Spanier flogen vom Festland extra auf die kanarische Insel. Gott bewahre, wenn das Glückslos mal aus Melilla kommt.
Und am 22. Dezember ist die Ziehung.
Sie wird live im Fernsehen übertragen, mit Einschaltquoten jenseits derer von Fußball-Weltmeisterschaften oder Königskrönungen, mit Freudenschreien und Herzinfarkten im ganzen Land.
Eine Besonderheit ist, dass die gewinnenden Losnummern sowie der jeweils darauf entfallende Preis von Kindern aus dem San-Ildefonso-Gymnasium in Madrid gesungen werden.
So geht das für mehr als 2000 Preise, den ganzen Tag lang. Aber in anderen Ländern machen die Leute ja auch nichts Sinnvolles an Weihnachten.
Warum die Kinder manchmal weinen? Tja, das ist so: Das San-Ildefonso-Gymnasium ist ein Waisenheim. Auf die Waisenkinder greift man schon seit mehr als 200 Jahren zurück, weil bei ihnen nicht die Gefahr besteht, von den Eltern zum Schummeln angestiftet zu werden. In früheren Zeiten gab es ausreichend Waisen, wahrscheinlich wegen Krieg und Krankheit und weil die Eltern nach Südamerika auswanderten, um El Dorado zu finden und Gold und Silber zu schürfen. Im 20. Jahrhundert, als natürliche Ereignisse keinen stetigen Nachschub an Waisenkindern mehr lieferten, halfen der spanische Staat und die katholische Kirche nach. Sie raubten unschuldigen Familien die Kinder, um sie zu Lottofeen und Chorknaben auszubilden.
Aber weil es für Weihnachten ist, heiligt der Zweck die Mittel.
Übrigens, gute Nachrichten für deutsche Glücksspieler: Seit 2013 wird zwar eine Quellensteuer abgeführt, aber weil in Deutschland Lotteriegewinne steuerfrei sind, können deutsche Glückspilze nach dem deutsch-spanischen Doppelbesteuerungsabkommen diese Steuern zurückfordern. – Vielleicht sollte ich mit diesem Wettbewerbsvorteil in spanischen Parks steuerfreie Gewinnanteile verkaufen?
Links:
- Mehr Weihnachtsgeschichten.
- Und weitere Berichte aus Spanien.